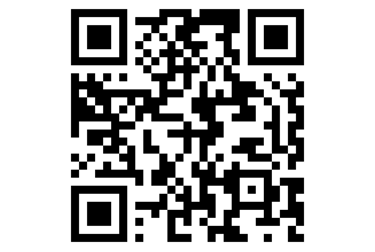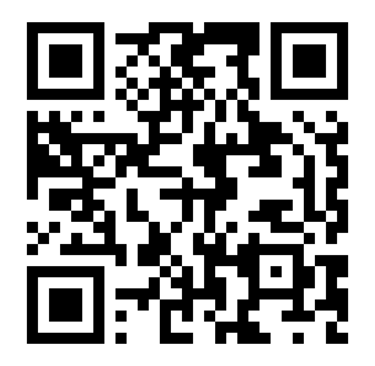OFFIZIELLER DISTRIBUTOR für
Deutschland - Österreich

THINKCAR PPS 10 - PPS 30 - PPS 100
Das THINKCAR Mobile Autobatterie-Ladegerät wurde entwickelt, um den modernen Anforderungen im Werkstatt- und Mobilservice gerecht zu werden. Für Mechatroniker, die täglich mit unterschiedlichen Batteriesystemen und komplexen elektrischen Bordnetzen arbeiten, bietet dieses Ladegerät eine kompakte, leistungsstarke und hochsichere Lösung. Durch seine intelligente Mikroprozessorsteuerung und fortschrittliche PWM-Technologie ermöglicht es ein präzises, batteriegerechtes und besonders effizientes Laden – sowohl im professionellen Werkstattumfeld als auch im mobilen Einsatz.
Kompakt, robust und sofort einsatzbereit
Die kleine Bauform erleichtert das Verstauen und den Transport erheblich. Ob im Diagnosewagen, Servicekoffer oder direkt im Fahrzeug – das Gerät ist jederzeit griffbereit. Trotz seiner Größe liefert es eine beeindruckende Ausgangsleistung und eignet sich damit für nahezu alle Fahrzeugsegmente.
Sicherheitsarchitektur für den professionellen Einsatz
In modernen Bordnetzen können Fehler schnell hohe Folgeschäden verursachen. Das THINKCAR Ladegerät setzt daher auf ein umfassendes Schutzpaket:
Überspannungs- und Überstromschutz
Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Temperaturstabiler Aufbau für dauerhaften Volllastbetrieb
Diese Sicherheitsfunktionen schützen Batterie, Ladegerät und Fahrzeugtechnik zuverlässig, selbst in anspruchsvollen Werkstattumgebungen.
Spezifikationen
Produkt PPS 10
Anwendung: 6V-12V
Eingangsspannung: 220V
Ausgangsstrom: 2/5/10A
Ausgangsleistung : 150 W
Display: Digital Tube
Batterie Kapazität: 8 ... 100 Ah




Spezifikationen
Produkt PPS 30
Anwendung: 12V-24V
Eingangsspannung: 220V
Ausgangsstrom: 5/10/20/30A
Ausgangsleistung : 900 W
Display: LCD Screen
Batterie Kapazität: 30 ... 360 Ah


Spezifikationen
Produkt PPS 100
Anwendung: 12V
Eingangsspannung: 220V
Ausgangsstrom: 5/10/30/60/100A
Ausgangsleistung : 1500 W
Display: LCD Screen
Batterie Kapazität: 40 ... 1000 Ah

LiFePO₄-Batterien liefern hohe Zyklenfestigkeit, konstante Spannung und deutlich weniger Gewicht.
Chemie und Sicherheit – was macht LFP anders?
LiFePO₄ ist eine Lithium-Ionen-Chemie, bei der das Kathodenmaterial aus Lithium-Eisenphosphat besteht. Das sorgt für:
Thermische Stabilität: Die Zersetzung beginnt erst über ~250–300 °C.
Bleisäure kocht viel früher, NMC-Lithiumzellen zerfallen bereits bei deutlich niedrigeren Temperaturen.
⇒ Weniger Risiko für Thermisches Durchgehen („Thermal Runaway“).Flache Entladekurve: Zwischen 20–80 % SoC liegt die Zellspannung fast konstant bei 3,2–3,3 V.
Beispiel:
Eine 12,8-V-LFP (4 Zellen in Reihe) hält unter Last oft stabil > 12,5 V, selbst bei 50 % Restkapazität.Kein Sulfatieren, keine Gasung wie bei Bleibatterien.
Diese physikalische Stabilität ist der Grund, warum LFP die bevorzugte Chemie für langlebige Energiespeicher ist.
Besondere elektrische Eigenschaften
Hier entscheidet sich, ob die Batterie im Fahrzeug richtig funktioniert.
Nominalspannung und Ladeschlussspannung
4 LiFePO₄-Zellen in Serie → 12,8 V Nennspannung
Ladeschlussspannung: 14,2–14,6 V
Erhaltungsladung („Float“) wird NICHT benötigt!
Beispiel:
Ein klassischer Blei-Ladebooster liefert 14,8 V und floatet danach bei 13,8 V – das überlädt ein LFP-System langfristig und sorgt für Zellungleichgewichte.
Innenwiderstand
LFP hat extrem niedrigen Innenwiderstand → hohe Ströme möglich.
Beispiel: 100-Ah-LFP kann 100–200 A liefern, ohne spürbaren Spannungseinbruch.
Das ist einerseits gut (Startermotoren laufen sauber), andererseits kritisch fürs Bordnetz:
Der hohe Strom kann bei Kurzschlüssen oder Fehlverdrahtung blitzschnell hohe Leistungen freisetzen.
BMS – das Herzstück jeder LFP-Batterie
Eine LiFePO₄ ohne BMS zu betreiben wäre wie ein Auto ohne Motorsteuergerät.
Aufgaben des Battery Management Systems:
Zellbalancing (Beispiel: Ausgleich, wenn eine Zelle bei 3,6 V steht und die anderen noch bei 3,45 V)
Überstromschutz
Tiefentladeschutz
Überladeschutz
Temperaturüberwachung (kritisch beim Laden)
Das BMS schaltet die Batterie hart ab, wenn Grenzwerte überschritten werden.
Für das Fahrzeug bedeutet das:
Kurzzeitige Spannungsausfälle → mögliche Steuergeräte-Resets oder Fehlerspeichereinträge.
Besonderheit: LFP darf bei Kälte nicht geladen werden
Ein Lithium-Ionen-Elektrolyt beginnt bei Temperaturen < 0 °C Probleme zu machen.
Der Lithium-Ionen-Transport wird langsam. Dadurch können sich beim Laden Lithium-Metall-Ablagerungen bilden (Lithium-Plating). Diese sind irreversibel und zerstören die Zelle langfristig.
Merke:
– Entladen bei Kälte ist unkritisch.
– Laden unter 0 °C ist schädlich.
Viele LFP-Batterien besitzen deshalb:
Temperatursensoren
Abschaltung der Ladefunktion
Heizmatten, die zuerst den Akku erwärmen
Beispiel:
Wohnmobile im Winter – LFP ohne Heizung wird vom Ladebooster gepusht → BMS schaltet ab → Spannungseinbruch → Verbraucher fallen aus.
Gerade weil LFP wie eine Bleibatterie aussieht, entstehen typische Diagnosefallen.
Typische Symptome:
Plötzliches Abschalten unter Last → BMS hat den Akku getrennt
Zellbalancingfehler → Akku lädt nicht voll
Ladegerät mit Bleiprofil → Überladung oder unvollständige Ladung
Fehlermeldungen vieler Steuergeräte → Spannungseinbruch beim BMS-Reboot
Praktischer Tipp:
Die Spannung eines LFP sagt wenig über den SoC aus.
Multimeter reicht nicht – man braucht:
Batteriemonitor
BMS-App
oder kennt die spezifische Kennlinie der Batterie
Besondere mechanische Aspekte
LFP wiegt weniger, aber ist empfindlich gegen:
mechanische Verformung der Zellen
falsche Montagepunkte
Hitzeeinwirkung vom Motorraum
Am besten immer geschützt einbauen und nie direkt an Abgassträngen oder Heizgeräten vorbeiführen.
Hauptunterschiede zwischen LiFePO₄ und Blei-Säure-Batterien
Spannungslagen & Ladekennlinie
LiFePO₄-Zellen haben eine nominale Zellspannung von 3,2 V (4 Zellen ergeben ca. 12,8 V).
Blei-Säure-Zellen haben nominale 2 V pro Zelle (6 Zellen ergeben ca. 12 V).
Die Ladespannung von LiFePO₄ ist deutlich niedriger als bei einer Blei-Batterie (max. 14,6 V statt 14,8–15 V).
LiFePO₄-Batterien benötigen eine konstante Ladespannung und dürfen nicht überladen werden.
Ladekennlinie & Lademethode
Blei-Säure-Batterien werden nach der IUoU-Kennlinie geladen:
I-Phase (Konstantstrom)
U-Phase (Konstantspannung)
Erhaltungsladung (Float-Charge)
LiFePO₄-Batterien brauchen eine CC/CV-Kennlinie (Constant Current / Constant Voltage), ohne Float-Ladung:
Kein Nachladen mit Erhaltungsladung nötig → Dauerhafte Ladung schädigt die Batterie!
Überladung kann die Batterie beschädigen oder gar zerstören.
Ladeströme
LiFePO₄ kann mit höheren Strömen geladen werden als Blei-Säure.
Schnellladung ist möglich, allerdings sollte der empfohlene maximale Ladestrom eingehalten werden
z. B. 10 A für eine 10 Ah Batterie.
Blei-Säure-Batterien müssen langsamer geladen werden, um Sulfatierung und Gasung zu vermeiden.
Tiefentladung & Balancing
LiFePO₄-Batterien haben ein Battery Management System (BMS), das die Zellspannungen überwacht und ausgleicht.
Tiefentladung ist für LiFePO₄-Batterien kritisch (Unter 2,5 V/Zelle kann sie irreversibel beschädigt werden).
Blei-Säure-Batterien können sich tiefer entladen (bis ca. 10,5 V), haben aber eine begrenzte Zyklenfestigkeit.
Daher braucht man ein spezielles Ladegerät, das:
Eine genau passende Ladespannung (meist 14,2–14,6 V) bietet.
Keine Erhaltungsladung (Float) hat.
Sanft abschaltet, wenn die Batterie voll ist.
Hochfrequenz-Puls-Ladung oder Desulfatierungsmodi deaktiviert hat.
Achtung: Viele Standard-Blei-Ladegeräte erkennen eine tiefentladene LiFePO₄-Batterie nicht, da diese unter 10 V oft als „defekt“ gewertet wird.
Diagnosetechnik Richter GmbH Geschäftsführer Mike Richter
Spinnereistr. 212a, 09405 Zschopau
Deutschland
+49 (0) 173 5887265
fahrzeugdiagnose.richter@gmail.com
UNTERNEHMEN
RECHTLICHE HINWEISE