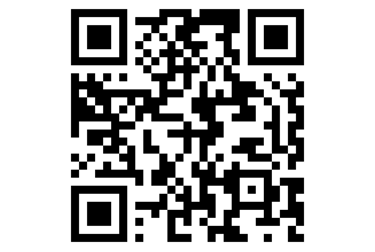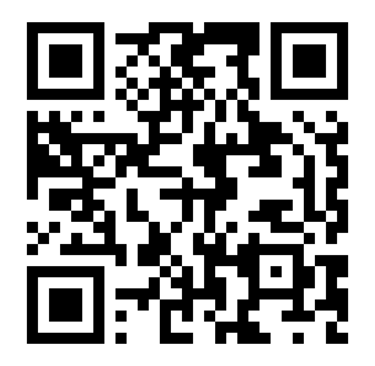OFFIZIELLER DISTRIBUTOR für
Deutschland - Österreich

Druckimpulse -Test mit einem Oszilloskop

Druckimpulssensor – das Diagnosewerkzeug für die “unsichtbaren” Motorvorgänge
Einleitung – Warum ein Druckimpulssensor so mächtig ist
In der modernen Fahrzeugdiagnose dreht sich vieles um elektrische Signale, Sensorwerte und Fehlerspeicher. Doch was passiert tatsächlich im Motor – in den Zylindern, im Ansaug- oder Abgassystem?
Genau hier kommt der Druckimpulssensor (Pressure Pulse Sensor, PPS) ins Spiel. Er macht die dynamischen Druckänderungen sichtbar, die bei der Arbeit der Zylinder entstehen – ganz ohne mechanische Eingriffe. Damit lassen sich viele mechanische Probleme erkennen, ohne den Motor zu zerlegen.
Funktionsprinzip – wie der PPS arbeitet
Der Druckimpulssensor ist ein hochempfindlicher piezoelektrischer Wandler, der nur Druckänderungen in Gasen erfasst. Er misst nicht den statischen Druck, sondern ausschließlich die Schwankungen um den Mittelwert.
Beispiel:
Ein konventioneller Drucksensor zeigt dir 0,8 bar Unterdruck im Ansaugkrümmer.
Der PPS zeigt dir dagegen die schnellen Druckschwingungen, die entstehen, wenn die Ventile öffnen und schließen – also den „Atemrhythmus“ des Motors.
Diese Druckimpulse werden in elektrische Spannungssignale umgewandelt und über ein BNC-Kabel direkt an ein Oszilloskop weitergegeben.
Ein typischer Ausgangsbereich liegt zwischen ±0,5 bis ±10 V, und das Signal kann bis zu 5 kHz schnell sein – also mehr als ausreichend, um selbst schnelle Ventilbewegungen oder Verbrennungstakte sichtbar zu machen.
Typische Einsatzbereiche
Der Druckimpulssensor kann an mehreren Stellen im Fahrzeugsystem eingesetzt werden – jeweils mit unterschiedlichem Diagnosefokus:
Anschlussstelle
Abgasanlage (Endrohr)
Druckwellen der einzelnen Zylinder Zylindervergleich,Ventilundichtigkeiten
Ansaugkrümmer
Unterdruckpulsationen Ventilsteuerzeiten, Kompression, Ansaugprobleme
Kraftstoffdruckregler (Unterdruckseite)
Membranbewegungen durch Einspritzvorgänge Einspritzverhalten, verschmutzte oder klemmende Injektoren
Kurbelgehäuse-Entlüftung
Druckpulsation durch Blow-by-Gase Kolbenringe, Kompressionsverluste
Praktischer Nutzen – was der Mechatroniker sieht
Beim Betrieb des Motors erzeugt jeder Zylinder charakteristische Druckmuster. Wenn ein Zylinder aus dem Takt läuft (z. B. durch Kompressionsverlust, Ventilleck oder Injektorproblem), verändert sich der Verlauf der Pulswelle deutlich.
Beispiele aus der Praxis:
Burnt Valve (verbranntes Ventil)
→ Der Ansaugpuls ist asymmetrisch und schwächer – weil der Zylinder seine Kompression verliert.
→ Im Oszilloskopbild ist das als „eingefallene“ Welle sichtbar.Defekter oder verschmutzter Injektor
→ Beim Anschluss an den Kraftstoffdruckregler zeigt sich eine unregelmäßige Pulsation, da die Membran unterschiedlich weit ausschlägt.
→ Besonders bei sequentieller Einspritzung kann man so den betroffenen Zylinder lokalisieren.Zündaussetzer / mechanische Unwucht
→ Deutlich ungleichmäßige Pulsfolge über die Zeitachse – der „Motorpuls“ ist nicht mehr rhythmisch.
Vorteile gegenüber herkömmlicher Druckmessung
Normale elektronische Drucksensoren messen statischen Druck – also den absoluten Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Der PPS dagegen ignoriert den Mittelwert und zeigt nur die dynamischen Schwankungen. Dadurch lassen sich:
kleinste Änderungen im Gasfluss erkennen,
Ventilüberschneidungen analysieren,
zeitliche Zusammenhänge zwischen Zylindern darstellen.
Mit einem einfachen Oszilloskop (z. B. PicoScope, Bosch FSA etc.) lässt sich so in Echtzeit das „Innenleben“ des Motors sichtbar machen – ohne Kompressionsprüfung, Endoskop oder Zylinderkopfabbau.
Praktische Durchführung
Sensor anschließen
BNC-Stecker an den Scope-Eingang anschließen.
Druckschlauch an die Messstelle (z. B. Unterdruckanschluss im Ansaugkrümmer).
Keine Spannungsversorgung nötig!
Motor starten und Signal beobachten
Im Leerlauf erkennt man den Grundpuls des Motors.
Beim Gasstoß verändern sich Amplitude und Frequenz deutlich.
Mit einem Zylindersynchronisationssignal (z. B. Zündkabel Zyl. 1) kann man die Pulsbilder den einzelnen Zylindern zuordnen.
Signale interpretieren
Symmetrische, gleichmäßige Wellen → Motor mechanisch gesund.
Asymmetrische oder verschobene Pulse → mögliche Störung.
Kombination mit Kurbelwellensignal → präzise Zuordnung zur Taktfolge (Ansaugen, Verdichten, Arbeiten, Ausstoßen).
Beispielhafte Signalauswertung
Cranking (Motor wird nur gestartet):
→ Sinusähnliche Kurven – gute Vergleichbarkeit zwischen Zylindern.Leerlauf:
→ Wellenförmige Kurven mit klaren Spitzen und Tälern; jede Spitze entspricht einem Arbeitstakt.Fehlerfall (z. B. verbranntes Ventil):
→ Deutlich abgeflachte oder unregelmäßige Pulse.
Warum der PPS in keiner Diagnosestation fehlen sollte
Der Druckimpulssensor ist ein Gamechanger für Mechatroniker, die Motoren wirklich verstehen wollen.
Er liefert sichtbare, dynamische Informationen über Verbrennungs- und Strömungsvorgänge, die bisher nur mit großem Aufwand messbar waren.
Vorteile im Überblick:
Nicht-invasiv: Kein Zerlegen, kein Kompressionstester nötig
Schnelle Fehlersuche bei Ventil-, Injektor- und Zylinderproblemen
Kompatibel mit nahezu jedem Oszilloskop
Ideal für Vergleichsmessungen zwischen Zylindern
Wer den PPS beherrscht, erweitert seine Diagnosekompetenz enorm – vom reinen Fehlerspeicher-Leser zum echten Motoranalytiker.
Diagnosetechnik Richter GmbH Geschäftsführer Mike Richter
Spinnereistr. 212a, 09405 Zschopau
Deutschland
+49 (0) 173 5887265
fahrzeugdiagnose.richter@gmail.com
UNTERNEHMEN
RECHTLICHE HINWEISE